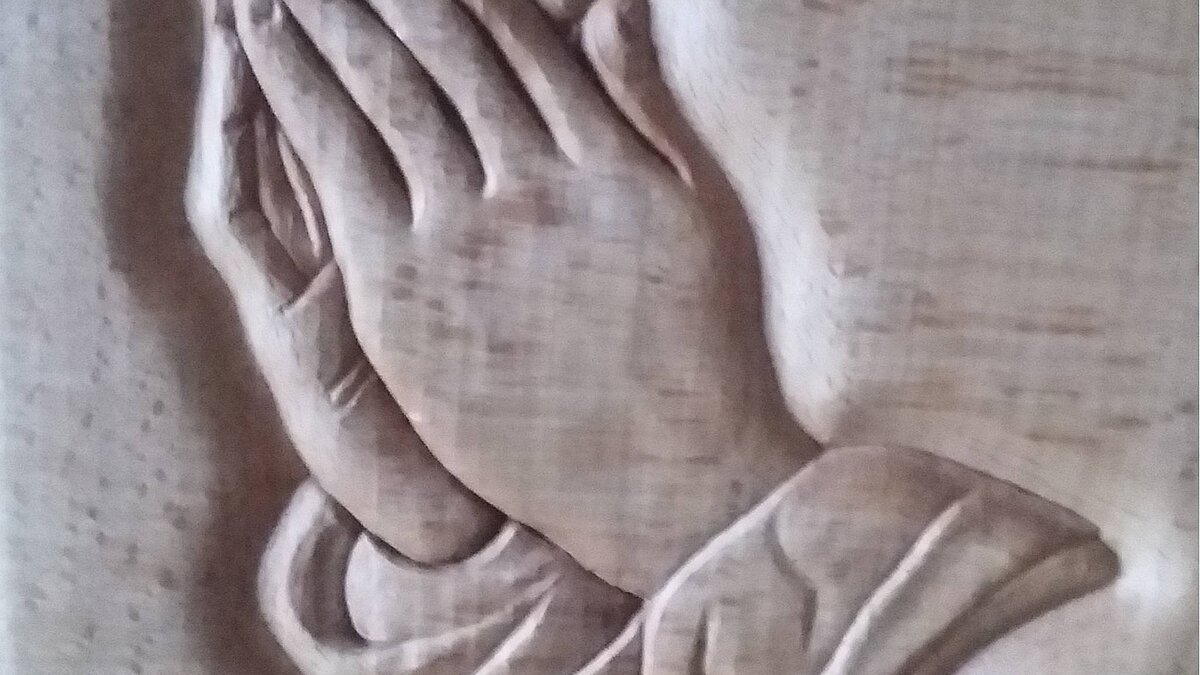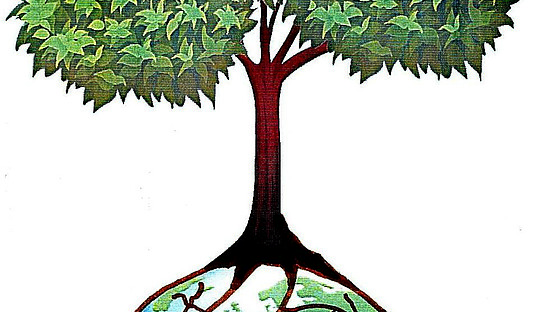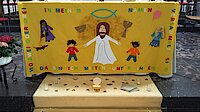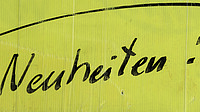Beten Sie mit uns (von zu Hause aus)...
Herzliche Einladung, mit uns zu beten, wenn Sie krankheits- oder altersbedingt nicht mehr unsere Gottesdienste besuchen können: i.d.R. samstags um 18.30 Uhr (zum Gebetsläuten). Sie brauchen dazu nur ein Gesangbuch und die unten stehenden Impulse.
Abfolge (z.B.): GL 627/1 - Schriftvers und Impuls - GL 631/4 - Gebet(slied) - GL 632/2 - GL 632/4.
Lesen Sie bitte unten weiter...
Ein Link zu Ausmalbildern für Kinder findet sich unter den Impulsen.
LICHTBLICKE - Gebetsimpulse im Juni 2025
Pfingsten (07.06./08.06.): Umschwung und Übergang
Aus dem Evangelium: „Jesus sagte noch einmal zu ihnen: ´Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. […] Empfangt den Heiligen Geist!´“ (Joh 20,20f.). --- Impuls: Von seinem christlichen Ursprung her ist Pfingsten ein Fest des Umschwungs und des Übergangs. Eine verängstigte, kleine Jüngergemeinde lässt sich aussenden, legt alle Furcht ab, erringt die Freiheit des Glaubens und öffnet sich so hin zu einer Weltgemeinschaft. Pfingsten ist die mutige Verkündigung der Frohen Botschaft in der Kraft des Heiligen Geistes: Alle Apostel werden mit dem Heiligen Geist erfüllt, beginnen in fremden Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen eingibt, und verkünden so der Welt Gottes große Taten (vgl. Apg 2,1-11). So werden sie dem Sendungsauftrag gerecht, den sie durch den Auferstandenen erhalten haben (vgl. Joh 20,20); denn alle Menschen sollen den Heiligen Geist als den Herrn und Lebensspender (vgl. Röm 8,11) empfangen. --- Dabei sind die Jünger nicht auf sich allein gestellt, denn der Auferstandene haucht ihnen den Heiligen Geist zu (vgl. Joh 20,21), der ihnen beistehen, sie alles lehren und sie an alles erinnern wird, was er ihnen gesagt hat (vgl. Joh 14,26). –- Doch auch wenn alle dabei mit demselben Heiligen Geist beschenkt werden, soll doch jede(r) für die Verkündigung die Gaben und Talente nutzen, die ihr/ihm durch den Geist aus Gnade zuteilgeworden sind; denn jeder erhält eine ihm je eigene Offenbarung des Heiligen Geistes, die zum Wohl und Nutzen aller eingesetzt werden soll; so werden alle Menschen durch die Taufe in dem einen Leib Christi wirklich vereinigt (vgl. 1 Kor 12, 4.7.13) und nicht „vereinheitlicht“ (vgl. den 7. Ostersonntag). --- Der Sendungsauftrag des Auferstandenen gilt auch uns heute. Auch wir sollen den Menschen mutig (und mit unseren je eigenen Begabungen) weitersagen, dass wir alle durch Jesus Christus im Heiligen Geist Gemeinschaft mit Gott haben und uns so vor nichts und niemandem mehr zu fürchten brauchen. Glaube ist keine Privatsache, die man irgendwo vergraben sollte; durch uns sollen sich alle Menschen – vereint im Heiligen Geist – zu Gott und zu seinem Sohn Jesus Christus bekennen! --- Gebet (GL 348,4): „Du mächt´ger Hauch, unerschaff´ne Glut, / Geist des Herrn, gib Du uns neuen Mut, / dass wir Gottes Liebe den Menschen künden / und als Schwestern und Brüder uns finden. / Kyrieleis.“
Dreifaltigkeitssonntag (14.06./15.06.): Ein Gott in drei Personen
Aus dem Evangelium: „Alles, was der Vater hat, ist mein. Der Geist wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden.“ (vgl. Joh 16,15). --- Impuls: Im Namen des dreifaltigen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, beginnen wir jeden Gottesdienst. Über die Frage, wie das zusammengehen kann (ein Gott in drei Personen) ist viel nachgedacht wor-den; Kritiker behaupten sogar, manche Theologen wüssten mehr über das „Innen-leben“ Gottes als Gott selbst... Letztlich ist jedoch eine Antwort auf die Frage nach dem Innenleben Gottes nicht entscheidend. Viel wichtiger ist, dass ohne die „Trinität“ Gottes nicht vernünftig erklärt werden kann, dass ein Gott, der radikal verschieden von der Welt ist, eine Verbindung zur Welt aufbauen und heilend an ihr handeln kann, ohne selbst Teil dieser Welt zu werden und damit aufzuhören, Gott zu sein. Dies kann nur vernünftig gedacht werden, wenn Gott in sich Beziehung ist und diese Beziehung auch uns umfasst. Daher besteht das unverzichtbare Fundament des christlichen Glaubens darin, dass wir durch Jesus Christus im Heiligen Geist Gemeinschaft mit Gott haben – und damit Anteil an einem Leben, das selbst der Tod nicht zerstören kann. Innerhalb dieser göttlichen Lebens-gemeinschaft offenbart sich dieser Gott nun auf „dreifaltige“ Weise: in der Person des Vaters, der der Schöpfer und der Grund unseres Lebens ist; in der Person des Sohnes, in dem Gott unser Bruder wurde und durch den er sich mit dem Men-schen auf eine Stufe gestellt hat, damit wir seine Liebe zu uns spüren und erfah-ren; in der Person des Heiligen Geistes, um uns in die Wahrheit der Erkenntnis Gottes zu führen, uns Mut und Kraft für unser Leben und unsere Sendung (vgl. dazu letzten Sonntag) zu schenken und uns zu Gebet und Dank zu befähigen, damit wir dem dreieinen Gott Lob und Ehre erweisen können. --- Dass Gott kein Gott ist, der nur in sich ruht oder nur sich selbst genügen möchte, wird schon im Alten Testament öfters angedeutet – z.B. in der Rede der göttlichen Weisheit (Spr 8,22-31): Von Anfang an ist sie bei Gott, aber sie ist auch in der Welt und bei den Menschen; sie hat ihren Ursprung in der Ewigkeit Gottes, durchdringt die Schöpfung und bestimmt die Geschichte der Menschen, bei denen zu wohnen ihr eine Freude ist (Spr 8,31). Für Paulus personifiziert sich diese göttliche Weisheit in Jesus Christus, den er Gottes Kraft und Weisheit nennt (vgl. 1 Kor 1,24). Viele Stellen im Neuen Testament beleuchten diese dreifaltige Lebensgemeinschaft Gottes, die auch den Glaubenden mit umfasst, immer wieder anders: So betont Paulus, dass wir Frieden mit Gott haben durch Jesus Christus in der Liebe, die ausgegossen ist durch den Heiligen Geist (vgl. Röm 5,1-5). Und auch Jesus selbst verweist auf diese Gemeinschaft mit Gott wenn er sagt, dass alles, was der Vater hat, ihm gehört und dass der Geist von dem, was ihm gehört, nehmen und es den Jüngern verkünden wird (vgl. Joh 16,15). --- Wer an (s)eine Anteilhabe am göttlichen Leben glaubt, für den verwandelt sich die Sicht auf die Welt: Er wird befreit von der Angst um sich selbst und sein Leben, was zu einem selbstlosen Handeln motivieren kann; auch der Umgang mit den Krisen des Lebens (den eigenen und denen, der anderen) wird sich dadurch wandeln. Wer glaubt, wandelt nicht nur sich, sondern baut auch mit an einer heilenden Veränderung der Welt. --- Gebet (vgl. GL 861,2): „O Seligkeit, getauft zu sein, in Christus eingesenket! / Am Leben der Dreieinigkeit ward Anteil mir geschenket. / Ich bin nun Kirche, Christi Glied. / Ein Wunder ist´s, wie das geschieht. / Herr, hilf mir beten, glauben.“ Amen.
Fronleichnam (19.06.): Bekenntnis – „Ein Stück Himmel auf Erden“
Aus dem Evangelium:„Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer dieses Brot isst, wird in Ewigkeit leben.“ (Joh 6,51-52). --- Impuls:Was im irdischen Leben noch nicht direkt sichtbar ist, wird sichtbar und v.a. erfahrbar gemacht durch Zeichen; so ist es auch mit der durch Jesus Christus im Heiligen Geist geschenkten Gemeinschaft mit Gott (vgl. dazu den Dreifaltigkeitssonntag). Brot ist die Nahrung des Alltags, Wein das Getränk des Festes. Unter diesen beiden zentralen „Gestalten“, mit diesen zentralen „Zeichen“ vollzieht sich das „Herrenmahl“ der Christen: das Gedächtnis des letzten Abendmahles Jesu mit seinen Jüngern, die heilige Eucharistie. Jesus Christus gibt in den Zeichen von Brot und Wein sein Fleisch und Blut – sich selbst – hin für das Leben der Welt, für diese Anteilhabe an der göttlichen Gemeinschaft. --- Der in Gen 14,18-20 erwähnte Melchisedek (ein Priester und König) bringt die Gaben der Erde und die Frucht der menschlichen Arbeit (Brot und Wein) Gott zum Opfer dar, bevor er sie Abraham zur Stärkung anbietet. Er wird damit zum Vor-Bild Jesu Christi, der sein Leben für seine Freunde hingibt und selbst (im eucharistischen Brot) stärkende Nahrung auf dem Weg durch das Leben sein will. Seine Opfergaben sind Vorbild jenes Opfers, dass sich immer dann neu vollzieht, wenn sich eine Gemeinde zum Herrenmahl versammelt; denn sooft sie Jesu Fleisch im Brot und sein Blut im Wein aufnehmen, verkünden sie seinen Tod bis zu seiner Wiederkunft (vgl. 1 Kor 11,23-26); denn immer dann, wenn wir ihn in der Kommunion auf diese Weise in uns aufnehmen, erfahren wir neu, dass auch wir als Glaubende Teil jener göttlichen Lebensgemeinschaft sind, an der uns Jesus durch seine Lebenshingabe am Kreuz Anteil gegeben hat. Das ist die eigentliche und wohl auch einzige Antwort auf den Hunger nach dem wahren Leben in Fülle, nach Erlösung, Liebe, Freude und Hoffnung in einer Welt, in der das Böse in seinen vielfältigsten Formen immer mehr auf dem Vormarsch zu sein scheint… --- Gott wird sein Volk niemals ohne Nahrung, die zum wahren Leben führt, lassen. Dieses Vertrauen will uns das Evangelium von der Speisung der Fünftausend (Lk 9,11-b-17). So sicher wie man dieses Evangelium als „Teilungswunder“ lesen kann (Teilen kann dazu führen, dass am Ende im Überfluss da ist), so unverkennbar ist auch die Tatsache, dass Lukas dieses Wunder im Zusammen-hang mit dem letzten Abendmahl Jesu und mit der Eucharistiefeier der Urge-meinde verstanden wissen will. So verweist das Segnen, Brechen und Austeilen des Brotes (vgl. Lk 9,16; Lk 22,19; 1 Kor 11,24) darauf, dass die eigentliche Brotvermehrung hier darin besteht, dass sich Jesus als das wahre Lebensbrot hier selbst austeilt und so den „geistlichen“ Hunger unzähliger Menschen (es hätten mehr als 5.000 sein können) zu stillen vermag. --- Der Fronleichnamstag kann für uns eine gute Gelegenheit sein, uns freudig zu dem (in der Öffentlichkeit) zu bekennen, in dem wir Heilung und Heil (sozusagen ein Stück Himmel auf Erden!) finden können: zu Jesus Christus, dem Brot, das lebendig ist und das den Hunger nach einem Leben in Fülle zu stillen vermag. --- Gebet(GL 497,5): „Denkmal, das uns mahnet an des Herren Tod. / Du gibst uns das Leben, o lebendig Brot. / Werde gnädig Nahrung meinem Geiste Du, / dass er Deine Wonnen koste immerzu.“ / Amen.
12. Sonntag im Jahreskreis – C (21.06./22.06.): Für wen haltet ihr mich?
Aus dem Evangelium: „´Ihr aber, für wen haltet ihr mich?´ Petrus antwortete: ´Für den Messias Gottes.´ Doch er verbot ihnen streng, es jemand weiterzusagen. Und er fügte hinzu: ´Der Menschensohn […] wird getötet werden, aber am dritten Tag wird er auferstehen.´“ (Lk 9,20-22). --- Impuls: Der Fronleichnamstag (s.o.) hat uns Jesus Christus als lebendiges Brot vor Augen gestellt, das unseren Hunger nach einem Leben in Fülle zu stillen vermag. Wenn wir im Alltag gefragt werden, wer Jesus für uns ist, und wir darauf (hoffentlich) eine Antwort geben können, wird diese wohl anders, vielfältiger, vielleicht auch einfacher ausfallen. --- Wenn Jesus im heutigen Evangelium seinen Jüngern die Frage stellt, für wen sie ihn halten (vgl. Lk 9,20), sind auch wir neu zu einer Antwort herausgefordert. Also: Wer ist Jesus für Sie/Dich? Die biblische Antwort auf diese Frage setzt sich zusammen aus dem Christusbe-kenntnis des Petrus (Lk 9,20), der Leidensankündigung Jesu (Lk 9,22) und der Aufforderung zur Kreuzesnachfolge (Lk 9,23f.). Das bedeutet: Jesus ist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, der „Heiland“, der für uns am Kreuz getötet wurde und für uns auferstanden ist, damit die, die ihm nachfolgen, in ihm das Leben in Fülle bzw. bleibende Gemeinschaft mit Gott haben und „im Heil“ sind (vgl. Lk 9,20-24). --- Bereits der Prophet Sacharja verheißt einen solchen Retter, dessen Lebenshingabe Heilung bringt. Bei ihm ist es noch eine geheimnisumwitterte königlich-prophetische Märtyrergestalt, deren gewaltsamer Tod bei den Einwohnern Jerusalems sowohl zu einer katastrophalen Erschüt-terung (Sach 12,10) wie auch zu einer von Gottes Geist gewirkte Läuterung durch Reue und Umkehr führt (Sach 13,1); das Johannesevangelium wird diese Märtyrergestalt, die „durchbohrt“ wurde, mit dem durchbohrten Christus am Kreuz identifizieren (vgl. Sach 12,10 und Joh 19,37). --- Dass Jesus Christus (auch für ihn) der „Heiland“ ist, der allen, die glauben, ein Leben geschenkt hat, das sogar über den Tod hinaus währt, zeigt Paulus z.B. in Gal 3,26-29: Alle Getauften haben durch den Glauben die Gotteskindschaft in Christus Jesus, haben Christus als Gewand angelegt, sind eins in ihm (weshalb ihre Unterschiede zweitrangig werden) und als „Angehörige“ Christi Nachkommen Abrahams und Erben kraft der Verheißung. --- Jesus Christus könnte für uns also der sein, der uns durch seinen Tod und seine Auferstehung bleibende Gemeinschaft mit Gott bzw. Anteil an seinem ewigen Leben bei Gott geschenkt hat. --- Gebet (GL 804,3): "O Quell´, der unser Leben nährt, / o Herz, das sich für uns verzehrt, / schließ uns in Deine Liebe ein / und lass´ uns immer bei Dir sein.“ Amen.
13. Sonntag im Jahreskreis – C (28.06./29.06.): Entscheidung
Aus dem Evangelium: „Keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat, und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes." (Lk 9,62). --- Impuls: Wer Jesus Christus als den Heiland erkannt hat (vgl. letzten Sonntag), der wird auch vor die Entscheidung gestellt, ob er an ihn glauben und ihm nachfolgen will oder nicht. Den meisten von uns ist diese Entscheidung allerdings zunächst abgenommen worden; andere haben bei unserer Taufe für uns entschieden. Auch wenn wir durch die Taufe dazu berufen sind, am Aufbau des Reiches Gottes mitzuwirken, können wir auf dem Weg der Nachfolge manchmal lahm und müde werden, können uns ernsthafte Zweifel kommen, ob dieser Weg für uns der richtige ist. Das vielfältige Leid auf der weiten Welt oder auch in unserem ganz persönlichen Leben, Krisenerfahrungen, Enttäuschungen, die uns Menschen oder auch Institutionen wie die Kirche bereiten oder die Herausforderungen und Belastungen, die das alltägliche Leben mit sich bringt uvm. können dazu führen, den Weg der Nachfolge zu verlassen oder ihn gar nicht erst einzuschlagen. --- Jesus, der entschieden seinem Leidensweg entgegengeht, trifft auf dem Weg nach Jerusalem Menschen, die ihm zwar nachfolgen wollen, dann aber, als sie erfahren, was Nachfolge wirklich bedeutet, einen Rückzieher machen (vgl. Lk 9,51-62): den einen schreckt das Fehlen einer wirklichen irdischen Heimat und die Ruhelosigkeit ab (Lk 9,57f.), der zweite zieht (vermeindliche?) irdische Verpflichtungen der Nachfolge vor (Lk 9,59f.), ein dritter fürchtet sich vor dem Verlust familiärer Bindungen (Lk 9,61f.). Nachfolge im Sinne Jesu ist immer vorbehaltlos und fordert den ganzen Menschen. Als Vorbild dafür kann die Berufungsgeschichte des Elischa (vgl. 1 Kön 19,16b.19-21) dienen. --- Doch: Wer von uns, die wir alle irgendwo dem Irdischen verhaftet sind, taugt dann noch für die Nachfolge? Der, der gerufen wird und den freien Mut hat, sich wie Jesus in die Hand Gottes zu geben! Die Entscheidung, sich von Gott in Dienst nehmen zu lassen, wird nie ein für alle Mal gefällt. Man muss immer wieder um sie kämpfen, sie immer wieder erneuern. Dabei kommt es nach Paulus v.a. darauf an, einander in Liebe zu dienen und sich bei allem vom Heiligen Geist leiten zu lassen (vgl. Gal 5,1.13-18). --- Unsere persönliche „Berufungsgeschichte“ ist vielleicht niemals abgeschlossen ist, aber sie dauert noch immer an und wir können sie jederzeit neu beginnen! Dass wir heute der Einladung zur Mitfeier des Gottesdienstes gefolgt sind, kann ein neues Zeichen unserer Bereitschaft zur Nachfolge sein. So können wir heute wieder auf Jesus Christus und sein Wort hören, die Hand wieder neu an den Pflug legen, das Zurückschauen vermeiden und wieder entschiedener am Aufbau seines Reiches mitarbeiten. --- Gebet (GL 455,2): „Alles meinen Gott zu ehren, alle Freude, alles Leid! / Weiß ich Doch, Gott wird mich lehren, was mir dient zur Seligkeit. / Meinem Gott nur will ich leben, seinem Willen mich ergeben. / Hilf, o Jesu, allezeit, hilf, o Jesu, alle Zeit.“ Amen.
14. Sonntag im Jahreskreis – C (05./06.07.): Frieden
Aus dem Evangelium: „Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes: Friede diesem Haus! Und wenn dort ein Mann des Friedens wohnt, wird der Friede, den ihr ihm wünscht, auf ihm ruhen; andernfalls wird er zu euch zurückkehren.“ (Lk 10,5f.). --- Impuls: Jeder Mensch sehnt sich nach Frieden – mit sich und mit anderen Menschen. Jesus Christus hat unserer Welt, die jeden Tag neu von so viel Unfrieden erschüttert wird, seinen Frieden als Vermächtnis hinterlassen (vgl. Joh 14,27). Gemeint ist damit nicht bloß irgendein Waffenstillstand, sondern der Friede Gottes, der alles menschliche Begreifen übersteigt und der in der durch Jesus Christus im Heiligen Geist geschenkten Gemeinschaft mit Gott besteht: Die Anteilhabe am Leben bei Gott kann den Menschen von aller Angst um sich selbst und von allem egoistischen Denken befreien, zeigt sich nach innen durch einen Frieden im Herzen und nach außen durch selbstloses Handeln. --- Dieser Friede ist zunächst eine Gabe Gottes. So mahnen und trösten späte Schüler des großen Jesaja das Volk, als es aus dem Babylonischen Exil zurückgekehrt ist (nach 538 v.Chr.), mit der Verheißung, dass nur Gott die Macht hat, Leben, Freude und v.a. Frieden zu schaffen, an denen alle Völker teilhaben sollen (vgl. Jes 66,10-14c; v.a. Jes 66,12!). --- Doch dieser Friede ist auch Aufgabe für uns. Denn der, der sich dazu entschieden hat, am Aufbau des Reiches Gottes mitzuwirken (vgl. dazu den letzten Sonntag), soll den Frieden, der er selbst im Glauben erfährt, als Einladung auch an alle Menschen weitergeben, wozu Jesus seinen Jüngern Handlungsanweisungen mit auf den Weg gibt. Dabei ist entscheidend, dass die 72 Jünger bei ihrer Verkündigung des nahen Reiches Gottes weder durch Missionserfolge überheblich werden, noch sich durch Missionsmisserfolge nieder-drücken lassen sollen (alle Jünger werden beide Erfahrungen machen!); sie sollen sich nur darüber freuen, dass ihre Namen im Himmel verzeichnet sind, sie also schon in Gemeinschaft mit Gott leben und dass der Friede, den sie weitergeben, schon auf ihnen ruht (vgl. Lk 10,1-12.17-20). --- Der Friede Jesu Christi kann helfen, auch irdische Streitigkeiten endgültig beizulegen. Das zeigt Paulus am Beispiel des Streits um die Beschneidung (vgl. Gal 6,14-18): Nicht auf sie kommt es an, sondern darauf zu erkennen, dass durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi eine neue Schöpfung im Werden ist, deren „Grundgesetze“ der Glaube und die gegenseitige Liebe sind und mittels derer sich alte Unterschiede und Gegensätze in Luft auflösen. Wer sich als Teil dieser neuen Schöpfung begreift, dem sind Friede und Erbarmen verheißen. --- Unsere Kirchortgemeinde in Friedrichsthal feiert an diesem Wochenende die Weihe ihrer Kapelle („Kerb“). Beten wir darum, dass möglichst viele Menschen, wenn sie diese Kapelle zum Gottesdienst oder auch zum stillen Gebet aufsuchen, etwas spüren von jenem Frieden, den die Welt nicht geben kann, und dass sie diesen Frieden an andere Menschen weiterschenken. --- Gebet (GL 478,3): „Die Kirche ist erbauet auf Jesus Christ allein. / Wenn sie auf ihn nur schauet, wird sie im Frieden sein. / Herr, Dich preisen wir, auf Dich bauen wir; / lass´ fest auf diesem Grund uns steh´n zu aller Stund´.“ Amen.
LICHTBLICKE - Gebetsimpulse im Juli und August 2025
15. Sonntag im Jahreskreis – C (12./13.07.): „Nächsten“ begegnen
Aus dem Evangelium (Lk 10,36f.): „´Wer von diesen dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der von den Räubern überfallen wurde?´ ´Der, der barmherzig an ihm gehandelt hat.´ ´Dann geh´ und handle genauso!´“
Impuls: Am ersten Juli-Wochenende haben auch in Hessen wieder die Sommerferien begonnen. Vielen von uns bietet sich dann vielleicht wieder Gelegenheit, andere Länder und Kulturen kennenzulernen, anderen Menschen zu begegnen. Vieles mag uns dabei dann möglicherweise fremdartig vorkommen… Würden wir „wildfremde“ Menschen an anderen Orten bzw. in anderen Ländern als unsere „Nächsten“ bezeichnen? --- Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk 10,25-37) macht uns an diesem Sonntag deutlich, dass unsere „Nächsten“ diejenigen sind, die uns (wo auch immer) begegnen und unsere Hilfe brauchen. --- Motivation für solch uneigennütziges Handeln aus Liebe kann ein Gedanke aus Kol 1,15-20 sein: Jesus Christus nimmt in der Welt eine universale und zentrale Stellung ein; durch ihn und auf ihn hin ist alles geschaffen, in ihm hat alles Bestand; er ist das Haupt des Leibes, der die Kirche ist; sein Tod am Kreuz für uns ist der Weg, über den alles im Himmel und auf der Erde Anteil erhält an der göttlichen Lebensgemeinschaft und damit Versöhnung und Friede erlangt. Der Glaube, durch Christus im Heiligen Geist wieder ganz nahe bei Gott zu sein, kann uns von der Angst um uns selbst befreien und lässt uns selbstlos handeln; er eröffnet uns v.a. aber auch den Blick darauf, dass wir in dem Nächsten, dem wir unsere helfende Hand reichen, Jesus Christus selbst begegnen: Denn weil dieser alles und in allen ist (vgl. Kol 3,11), ist Nächstenliebe zugleich Christusliebe! --- Gott wohnt mit seiner ganzen Fülle in Jesus Christus (vgl. Kol 1,19). Darum ist Nächstenliebe aber nicht nur Christus- sondern zugleich auch Gottesliebe. Wer sich dem hilfsbedürftigen „Nächsten“ (und damit Jesus Christus selbst) in Liebe zuwendet, zeigt wahre Gottesliebe und die Bereitschaft, auf Gottes Wort zu hören, wie es bereits Mose dem Volk Israel aufgetragen hat (vgl. Dtn 30,10-14). Hier wird deutlich: Das Wort Gottes schwebt nicht irgendwo in unerreichbaren Sphären, und die Ausrede, es könne aus Unkenntnis nicht befolgt werden, gilt nicht: Es ist ganz nahe bei uns, in unserem Mund, in unserem Herzen (vgl. Dtn 30,14), denn es begegnet uns immer wieder ganz konkret: nämlich in unseren hilfsbedürftigen Nächsten, die uns (quasi intuitiv) immer wieder neu an es erinnern. --- Im Gottesdienst begegnen wir auf ganz unterschiedliche Weise Jesus Christus: in seinem Wort, das uns heilen und unsere seelischen Wunden verbinden, und im Brot des Lebens, das unseren Hunger nach einem erfüllten Leben stillen möchte. So wird Jesus, dessen „Nächste“ wir sind, auch für uns zum guten Samariter. Beten wir daher darum, dass wir nach seinem Beispiel die Kraft und den Mut finden, denen gute Samariter(innen) zu sein, die uns und unsere Liebe brauchen. ►
Gebet (GL 440, 2+4): „Hilf, Herr, meiner Tage, / dass ich nicht zur Plage, / dass ich nicht zur Plage / meinem Nächsten bin. – Hilf, Herr, meiner Seele, / dass ich dort nicht fehle, / dass ich dort nicht fehle, / wo ich nötig bin.“ Amen.
16. Sonntag im Jahreskreis – C (19./20.07.): Nur eines ist notwendig
Aus dem Evangelium (Lk 10,41f.): „Marta, Marta, Du machst Dir viele Sorgen und Mühen. Aber nur eines ist notwendig. Maria [die sich mir zu Füßen gesetzt und auf meine Worte gehört hat] hat das Bessere gewählt.“
Impuls: Oft haben wir Menschen den Eindruck, als gehe es im Leben nur darum, wie eine Maschine zu funktionieren; und wenn wir nicht (mehr) funktionieren, bricht alles zusammen. Vieles nimmt uns im Alltag in Anspruch, vielen Erwartungen müssen wir genügen, manchmal wird es hektisch; mitunter wissen wir nicht, was wir zuerst machen sollen, wo uns der Kopf steht… Mit dieser Einstellung kann so manches andere, was ebenso wichtig ist, unter die Räder kommen; bereits das Evangelium des letzten Sonntags (Lk 10,25-37), wo berichtet wird, wie ein Priester und ein Levit so sehr durch ihre Pflichten in Beschlag genommen zu sein scheinen, dass sie keine Möglichkeit sehen, ihrem notleidenden Nächsten am Straßenrand helfend zu begegnen, kann auch das zeigen… Sicher: Arbeit und Mühe sind und bleiben wichtig – das menschliche Leben besteht nicht nur Müßiggang; doch wir Menschen brauchen auch Zeiten der Besinnung und der Erholung für Leib und Seele, sonst droht uns der Zusammenbruch! Gut, dass so manche von uns derzeit wieder Ferien und Urlaub genießen können! --- Wenn Gott heute zu uns als Gast käme, wie würden wir reagieren? Mit Geschäftigkeit? Abraham nimmt ihn in Gestalt dreier Männer, die unerwartet und unauffällig vor seinem Zelt auftauchen, gastfreundlich auf, denn er will ihn nicht vorbeiziehen lassen, ohne ihm Gutes zu tun (vgl. Gen 18,3ff.); als „Lohn“ für seine Gastfreundlichkeit verheißt Gott Abraham einen Sohn (vgl. Gen 18,10a). --- Ähnlich wie Abraham handelt auch Marta im heutigen Evangelium (vgl. Lk 10,38-42): Sie nimmt Jesus (und damit Gott selbst) freundlich auf, will sich als gute Gastgeberin zeigen, ist aber so sehr von ihren Gastgeberinnenpflichten in Beschlag genommen, dass sie nicht merkt, dass Jesus nicht zu seinen Freunden gekommen ist um zu empfangen als vielmehr zu geben. Es kommt ihm mehr darauf an, dass sein Wort vertrauensvoll gehört und in Taten umgesetzt wird (vgl. Lk 11,28), als dass man ihn unentwegt bewirtet. Das hat Martas Schwester Maria, die sich Jesus zuhörend zu Füßen setzt und über deren mangelnde Unterstützung sich Marta bitter beklagt, schnell begriffen. --- Gastfreundlichkeit, Arbeit, Fürsorge und Mühe bleiben wichtig; doch sie dürfen uns nicht abhalten von dem wirklich „Notwendigen“ und vom „Besseren“: vom Hören auf Gottes Wort. Denn dieses Hören führt uns in die Gemeinschaft mit Christus, der unter uns und die Hoffnung auf Herrlichkeit ist (vgl. Kol 1,27f.). Diese Christusgemeinschaft unentwegt zu verkündigen und ggf. auch für sie zu leiden, ist ein angemessener Dienst vor Gott (vgl. Kol 1,24-28), doch auch dieser darf sich nicht nur in Geschäftigkeit und Aktionismus erschöpfen, sondern braucht immer neu eine Rückbindung an Gott im fruchtbringenden Hören auf sein Wort. --- Der Gottesdienst bietet immer wieder neu die Chance, uns wieder auf das Wesentliche und Notwendige zu besinnen und zur Ruhe zu kommen; denn Gott kommt zu uns als Gast; hier dürfen wir uns (wie Maria – vgl. Lk 10,39) dem überlassen, der uns Freude, Frieden und v.a. bleibende Gemeinschaft mit ihm schenkt.
Gebet (GL 715, 2+3): „Du legst uns Deine Worte und Deine Taten vor. / Herr, öffne uns´re Herzen und unser Ohr. --- Herr, sammle die Gedanken und schick´ uns Deinen Geist, / der uns das Hören lehrt und Dir folgen heißt.“ Amen.
17. Sonntag im Jahreskreis – C (26./27.07.): Beten
Aus dem Evangelium (Lk 11,9): „Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann werdet ihr finden; klopft an, dann wird euch geöffnet.“
Impuls:Gottes Wort zu hören und danach zu handeln, ist das einzig Notwendige (vgl. den 16. Sonntag). Wo das (dauerhaft) nicht gelingt, kann das Gebet weiterhelfen. Doch auch mit dem Beten haben viele Menschen (auch wir?) ihre liebe Not: „Ich kann nicht beten!“ „Meine Gebete werden nicht erhört!“ „Das Beten bringt mir nichts!“… Solche oder ähnliche Klagen haben wir bestimmt selbst schon einmal gehört oder gar selbst ausgesprochen. --- Den Jüngern Jesu damals ging es wohl ähnlich, bitten sie ihn (vgl. Lk 10,38-42) doch darum, dass er ihnen das Beten lehrt. Jesus schenkt ihnen als „Grundform“ des Betens das „Vater unser“ und zeigt ihnen damit, dass Gott eben gerade nicht ein ferner Gott ist, den unsere Bitten und Anliegen nicht erreichen; im Heiligen Geist dürfen wir ihn als seine Kinder sogar „Papa“ nennen (vgl. Röm 8,15bc); ihm dürfen wir als Freund all unsere Sorgen, Ängste und Nöte anvertrauen... Zugegeben: Viele unserer Wünsche werden sich durch das Beten nicht oder anders als gedacht erfüllen; wer jedoch das Beten als „Wunscherfüllungsmechanismus“ versteht, hat in jedem Fall etwas missverstanden, wird schnell enttäuscht und bald frustriert aufgeben… Doch eines schenkt uns Gott auf jeden Fall und immer dann, wenn wir ihn darum bitten: den Heiligen Geist (vgl. Lk 11,13); dieser ist es, der uns hilft, uns in den göttlichen Willen „einzuschwingen“; er führt uns aus der Enge unserer persönlichen (und manchmal auch egoistischen) Wünsche und Hoffnungen in ungeahnte Weiten… --- Ein Vor-Bild für solches Beten ist Abraham, der mit Gott regelrecht verhandelt, um für die dem Untergang geweihten Städte Sodom und Gomorra um der Gerechten willen, die dort leben, Schonung zu erreichen (vgl. Gen 18, 20-32). Während seiner Verhandlungen mit Gott wird Abraham immer mehr bewusst, dass dieser Gott auch ein Freund des Lebens und ein Vater ist (vgl. Lk 11,8), der seine Kinder liebt und anders rechnet als wir: Schon wenige Gerechte würden genügen, um die Städte zu retten… Wenn es diese Gerechten doch bloß gegeben hätte! --- Letztlich wird es ein einziger Gerechter sein, der die vielen rettet: Jesus Christus, der Sohn Gottes, der für uns am Kreuz gestorben ist. Wer an ihn glaubt, ersteht durch die Taufe zu neuem Leben (vgl. Kol 2,12-14); durch ihn erhält er im Heiligen Geist Gemeinschaft mit Gott. Hier liegt letztlich auch der Grund, warum die Gebete des Glaubenden immer schon von Gott erhört sind: Weil er in Jesus Christus ist, hat er immer auch schon den Heiligen Geist empfangen. --- Bitten wir Jesus Christus, dass unser Beten in rechter Weise gelingen möge.
Gebet (GL 149,3): „O Du Glanz der Herrlichkeit, / Licht vom Licht, aus Gott geboren. / Mach´ uns allesamt bereit, / öffne Herzen, Mund und Ohren. / Unser Bitten, Fleh´n und Singen / lass´, Herr Jesu, wohl gelingen.“ Amen.
18. Sonntag im Jahreskreis – C (02./03.08.): Sinn des Lebens
Aus dem Evangelium (Lk 12,15): „Der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines großen Vermögens im Überfluss lebt.“
Impuls: Gelehrte Menschen zu allen Zeiten haben sich den Kopf darüber zerbrochen, was denn der Mensch und was der Sinn seines Lebens sei – eine Frage, die sich v.a. auch den Menschen unausweichlich stellt, die in eine Lebenskrise geraten: Wozu mühe und quäle ich mich eigentlich so? Es ist doch eh alles umsonst und vergeblich…! Der Prediger Kohelet (vgl. Koh 1,2; 2,21.23) kommt zur gleichen ernüchternden Erkenntnis: Alle menschlichen Bemühungen sind nichtig, sie sind (wie ein) „Windhauch“; denn der Besitz eines Menschen – angehäuft durch Wissen, Können und Erfolg und um den Preis von Sorge, Ärger und Ruhelosigkeit – kann jederzeit an jemanden fallen, der sich nicht angestrengt (und den Besitz auch gar nicht verdient) hat! Jesus warnt seinerseits aus dem gleichen Grund – erworbenen irdischen Besitz kann man jederzeit wieder verlieren – eindringlich vor jeglicher Habgier und vor dem „närrischen“ Versuch, dem eigenen Leben einzig durch Sammeln irdischer (vergänglicher!) „Schätze“ Sinn zu geben (vgl. Lk 12,13-21). --- Die Frage nach dem Sinn des Lebens kann nur von Gott her beantwortet werden: Er ist es, der uns den wahren Sinn und Reichtum unseres Lebens schenkt; nur von ihm wissen wir, was wir eigentlich sind: Gottes geliebte Kinder, die seine Liebe in der Welt ihrerseits erfahrbar machen können und sollen. Wer so handelt, sein Herz nicht an irdischen Reichtum hängt und sein Leben nicht durch Egoismus und Stolz beherrschen lässt, der ist vor Gott unendlich „reich“ und sammelt unentwegt Schätze im Himmel (vgl. Mt 6,20). --- Wer in Jesus Christus den erkennt, der alles und in allen ist (vgl. Kol 3,11), der findet den größten himmlischen Schatz. Nehmen wir uns in diesem Bewusstsein auch die Mahnung des Kolosserbriefs (vgl. Kol 3,1-5.9-11) zu Herzen, unseren Sinn vom „Irdischen“ (wie z.B. der Habsucht) auf das „Himmlische“ (nämlich die Einheit in Christus) zu lenken. Ein Weg dahin, dass diese Erkenntnis auch in unserem persönlichen Leben konkret wird, kann das Gebet – verstanden als Einschwingen in den Willen Gottes – sein (vgl. den 17. Sonntag).
Gebet (GL 381,4): „Behüt mich vor der stolzen Welt, / die allen Sinn dahingestellt, / von Dir mich abzuwenden. / Wenn sie nicht wird mein Meister sein, / so bleib´ ich durch die Gnade rein / in Deinen guten Händen.“ Amen.
19. Sonntag im Jahreskreis – C (09./10.08.): Fürchte Dich nicht!
Aus dem Evangelium (Lk 12,32): „Fürchte Dich nicht, Du kleine Herde! Denn euer Vater hat beschlossen, euch das Reich zu geben.“
Impuls: Dieses Trostwort Jesu scheint in unsere Zeit und Situation hineingesprochen: für diejenigen Christ/innen, die den Sinn ihres Lebens eben gerade nicht im Anhäufen irdischer Schätze sehen (vgl. den 18. Sonntag) und somit gegen den Strom schwimmen, und für die Gemeinden, die sich in unserer mehr und mehr säkularen Welt als machtlose Minderheit erfahren. Ihnen allen gilt unmissverständlich der Zuspruch, dass den Glaubenden die Zukunft, die himmlische Heimat, das „Reich Gottes“ gehört. --- Als Vor-Bild für die Zuverlässigkeit der Verheißungen Gottes und für ein dieser göttlichen Treue „angemessenes“ Verhalten seines Volkes erzählt Weish 18,6-9 vom Pesachfest des Volkes Israel kurz vor dessen Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei: In der Nacht, in der Gott alle Erstgeborenen der Ägypter erschlägt (vgl. Ex 11,4-7; 12,29), harrt es wachsam und in der zuversichtlichen Erwartung aus, dass „sein“ Gott durch das rettende Walten seiner Weisheit alle vorher gegebenen Zusagen einhält, die Feinde zugrunde richtet, die Gerechten aber bewahrt. … und Israel wird nicht enttäuscht; es darf und wird endgültig Ägypten verlassen… --- Auch wir sollen als Glaubende unsere wirkliche Situation in dieser Welt durch einen wachen Blick begreifen: Nicht ängstliche Sorge, sondern freudige Erwartung soll unser Leben bestimmen; wach sollen wir sein für die Aufgaben, die sich uns jetzt und hier konkret stellen, denn diese „Jetztzeit“ ist eine Zeit des Wartens – auf den Tag, an dem der Herr endgültig wiederkommt bzw. wir endgültig Anteil an jener göttlichen Lebensgemeinschaft erhalten, die uns Jesus Christus im Heiligen Geist schon im Hier und Heute durch seinen Tod und seine Auferstehung eröffnet hat. Wer daher mit wachem und bereitem Herzen den Tag erwartet, an dem sich in der Wiederkunft Christi alle göttlichen Verheißungen erfüllen und an dem auch wir in der himmlischen Heimat bzw. in Gottes Reich einen endgültigen Platz finden, der handelt im Sinne Jesu (vgl. Lk 12,35-58). Nach Hebr 11,1-2.8-19 hat schon Abraham ein solches Leben in furchtloser Erwartung gelebt und gilt daher mit Recht als „Urvater“ des Glaubens: Er zog als ruheloser Nomade in fremdes Land ohne zu wissen, wohin der Weg ihn führen wird. Die Stadt mit festen Grundmauern, die Gott selbst geplant und gebaut hat (vgl. Hebr 11,10), war ihm zwar verheißen, doch hat er sie in seinem irdischen Leben nie gesehen; die Tatsache, dass er jedoch trotzdem in seiner Suche nie nachließ, zeigt, dass es ihm letztlich nicht um eine neue irdische Heimat, sondern um ein Erreichen der himmlischen ging. --- Beten wir darum, dass die endgültige Gemeinschaft mit Gott unser wahrer Reichtum und unser wahres Lebensziel sei und dass wir so furchtlos unseren Lebensweg gehen.
Gebet (GL 435,3+4): „Lehr´ mich in der Erdenzeit / als ein Fremdling leben, / nach des Himmels Herrlichkeit / herzlich heimzustreben. / Und mein Zelt in der Welt / mag ich leicht verlassen, / Dich, Herr, zu umfassen. --- Gib auch, dass ich wachend sei, / Herr, an Deinem Tage / und das Licht der Gnaden treu / durch mein Leben trage, / dass ich dann fröhlich kann / Dir am End´ der Zeiten, / Herr, entgegenschreiten.“ Amen.
Unsere Pfarrei feiert an diesem Wochenende an der Marienkapelle das Hochfest Mariä Himmelfahrt vor. „Wie die Mutter Jesu, im Himmel schon mit Leib und Seele verherrlicht, Bild und Anfang der in der kommenden Weltzeit zu vollendenden Kirche ist, so leuchtet sie auch hier auf Erden in der Zwischenzeit, bis der Tag des Herrn gekommen ist, als Zeichen der sicheren Hoffnung und des Trostes dem wandernden Gottesvolk voran.“(vgl. LG Nr. 68). Der Mutter Jesu wurde also als erster der Glaubenden in ihrer Himmelfahrt das verheißene Reich schon endgültig zuteil. Wie sie werden auch alle, die an Jesus Christus glauben, das Reich erben.
20. Sonntag im Jahreskreis – C (16./17.08.): Frieden und Spaltung
Aus dem Evangelium (Lk 12,49.51): „Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. […] Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, nicht Frieden, sondern Spaltung.“
Impuls: Überall auf unserer Erde wüten Kriege mit ungewissem Ausgang (Russland óUkraine, Israel ó Iran…); die tieferen Wurzeln des Unfriedens sind Ungerechtigkeit, Egoismus, Missachtung der Menschenwürde, die Bedrohung der Freiheit uva. Dörfer, Städte, ganze Landstriche fallen in Schutt und Asche, Menschen verlieren ihre Existenz, vielleicht sogar ihr Leben... Und auch wenn den Glaubenden einst endgültig das Reich Gottes (das Reich der Liebe und des Friedens) verheißen ist (vgl. den 19. Sonntag), so sehnen auch sie sich doch nach einem friedlichen und erfüllten Leben nicht erst im Jenseits sondern bereits im Diesseits! Wieso fängt da jetzt auch noch Jesus mit Unfrieden und Spaltung an? --- Wer die Wahrheit sagt und vielleicht entschieden (in Zeiten drohenden oder bereits wütenden Krieges) für Frieden eintritt, der macht nicht selten die Erfahrung, dass er polarisiert und selbst Zwietracht sät, dass man ihm vorwirft, im eigenen Haus zu zündeln, und dass er vielleicht sogar sein Leben riskiert – eine Erfahrung, die auch die Propheten des Alten Bundes schon gemacht haben. Jeremia z.B. muss der Stadt Jerusalem den unausweichlichen Untergang prophezeien, wo nationalistische Kreise noch auf Rettung hoffen; darum bezichtigt man ihn, mit seinen zersetzenden Worten die Kampfmoral der noch verbliebenen Soldaten zu untergraben und statt Heil Unheil für das Volk zu wollen; er wird daher durch königliche Beamte in einer Zisterne „entsorgt“, schließlich aber doch gerettet (vgl. Jer 38,4-6.8-10); sein Versinken im Zisternenschlamm und seine Rettung durch den Kuschiter Ebed-Melech („Königsdiener“; der Name zeigt schon, dass die Rettung Jeremias letztlich auf Gottes wunderbares Wirken zurückzuführen ist; vgl. Ps 40,2-3) sind Vorausbilder des Todes und der Auferstehung Jesu. --- Auch dieser Jesus will keine faulen Kompromisse und keinen faulen Frieden. Er weiß, dass er mit seiner Botschaft vom nahen Reich Gottes auch aneckt und so manche Lunte zündet (vgl. Lk 12,49-53). In dem Wissen, dass der Heilige Geist das Feuer ist, in dem alles geprüft, geläutert und vollendet wird, geht er trotz vielfältiger Anfeindung konsequent den Weg ans Kreuz und gibt sein Leben, um allen, die glauben, wahren Frieden zu schenken; denn durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er uns eine unzerstörbare Gemeinschaft mit Gott eröffnet, die uns von allen Ängsten (auch der um uns selbst) befreien und jegliches egoistisches Handeln "wegbrennt". So kann aus diesem Frieden mit Gott ein gerechter Friede für die Welt wachsen, in dem aller Egoismus als wesentliche Ursache von Unfrieden überwunden werden kann. --- Um diesen Frieden zu erreichen, müssen diejenigen, die Jesus nachfolgen, manchmal ein deutliches Wort sagen, auch wenn sie damit auf Widerstand oder Unverständnis stoßen oder selbst Spaltung provozieren. Darum spricht der Hebräerbrief (vgl. Hebr 12,1-4) von einem Wettkampf, vom Kampf gegen die Sünde und vom Widerstand bis aufs Blut, die diejenigen auf sich nehmen müssen, die Jesus nachfolgen. Jesu Jünger müssen ihren Glauben immerzu bewähren – nicht nur gegen äußere Not wie z.B. Anfeindung oder Gleichgültigkeit, sondern auch gegen die innere wie die alltäglichen Probleme und Sorgen, die Trägheit uvm. Jesus Christus stärkt uns für diesen Dienst durch sein Vorbild und gib uns Kraft, uns unerschütterlich für den wahren Frieden in der Welt einzusetzen, der einzig aus der Lebensgemeinschaft mit Gott erwächst.
Gebet (GL 792,4): „Gib uns´rer Welt den Frieden, / lass´ uns zusammensteh´n / und Tag für Tag entschieden / des Friedens Wege geh´n. / Heiliger, dreiein´ger Gott, / Licht im Leben, Heil im Tod, / Dir sei Lob allezeit, / Preis und Dank in Ewigkeit.“ Amen.
An diesem Wochenende wird Kirchweih (Kerb) in Pfaffenwiesbach gefeiert, die Weihe des Ortes, an dem der „wahre Friede“ in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott gerade im Gottesdienst erfahren werden soll/kann. Dies sollte z.B. allen, die Gottesdienste in „ihrer“ Kirche vorbereiten und durchführen, allen, die Gottesdienste (regelmäßig) mitfeiern und auch allen, die Gottesdienste (regelmäßig) eher meiden, eine Mahnung sein.
21. Sonntag im Jahreskreis – C (23./24.08.): Wer wird gerettet?
Aus dem Evangelium (Lk 13,24.29): „Bemüht euch mit allen Kräften, durch die enge Tür zu gelangen, denn viele, sage ich euch, werden versuchen hineinzukommen, aber es wird ihnen nicht gelingen. […] Man wird von Osten und Westen und von Norden und Süden kommen und im Reich Gottes zu Tisch sitzen.“
Impuls: Werden wir gerettet? Wer erhält einen Zugang zum Reich Gottes? Ist es für die, die Jesus Christus nachfolgen und unermüdlich versuchen, Gottes Frieden auf die Erde zu bringen (vgl. den 20. Sonntag) selbstverständlich, dass sie einen festen Platz an Gottes Tisch finden? Oder grundsätzlicher: Bewegen uns diese Fragen überhaupt noch – uns, die wir in einer diesseits- und erlebnisorientierten Welt leben…? Spielt es für uns noch eine Rolle, wo wir nach dem Tod „landen“ – Hauptsache, man kostet dieses Leben voll aus und genießt es, solange es nur geht? Oder ist es nicht eher so, dass es für Christen letztlich auf beides ankommt: auf Diesseits- und Jenseitsorientierung? --- Ein Schüler des Propheten Jesaja schaut eine Völkerwallfahrt (vgl. Jes 66,18-21): Gott beruft die Völker aller Sprachen (auch die entferntesten), damit sie nach Jerusalem kommen und auf dem heiligen Berg in Jerusalem Gottes Herrlichkeit schauen; doch nicht alle aus diesem Völkergemisch werden schließlich als Opfergabe für den Herrn herbeigeholt und somit gerettet… --- Das Bestreben der Menschen, die Zukunft zu planen und sich möglichst nach allen Seiten abzusichern, stößt in Glaubensdingen an Grenzen. Glauben ist eben kein statisches Besitzen, sondern ständiges Bemühen um eine lebendige Beziehung zu Gott und zu den Mitmenschen. Das ist nicht leicht und überfordert manchmal. Vielleicht auch deshalb wird Jesus im heutigen Evangelium durch seine Jünger ängstlich gefragt, ob es nur wenige sind, die gerettet werden (vgl. Lk 13,22-30; 23!). Er antwortet auf diese Frage mit dem Bild der engen Tür, die zur rettenden Gottesgemeinschaft führt und zur Tischgemeinschaft im Reiche Gottes, zu der Menschen aus allen Himmelsrichtungen strömen (vgl. Lk 13,24.29); dagegen ist das Tor, das ins Verderben führt, breit und weit (vgl. Mt 7,14). Da also zwar viele zum „Himmel“ berufen, aber nur wenige erwählt sind (vgl. Mt 22,14; vgl. Jes 66,21!), ist es nicht egal, wie man im Diesseits lebt; es gibt auch keinen Anspruch auf das Jenseits, keine Platzvorbestellung, keinen Automatismus. Daher bleibt die Teilhabe an der rettenden Gottesgemeinschaft für alle Menschen zugleich Gabe Gottes und das Bemühen um sie lebenslange Aufgabe. --- Doch Gott will, dass alle Menschen gerettet werden (vgl. 1 Tim 2,4), weshalb Rückschläge im Leben auch „Erziehungsmaßnahmen“ Gottes darstellen können, die wieder auf den rettenden Weg zurückführen wollen (vgl. Hebr 12,5-7.11-13); da diese auf Heilung, Frieden und Leben abzielen, sollen sie daher nicht als Ent- sondern als Ermutigung verstanden werden, auf dem Weg, der zum Leben führt, weiterzugehen (vgl. Hebr. 12,12f.).
Gebet (GL 216,3): „O Herr verleih´, dass Lieb´ und Treu´ / in Dir uns all´ verbinden, / dass Hand und Mund zu jeder Stund´ / Dein Freundlichkeit verkünden, / bis nach der Zeit den Platz bereit´t / an Deinem Tisch wir finden.“ Amen.
22. Sonntag im Jahreskreis – C (30./31.08.): Gemeinschaft durch Demut
Aus dem Evangelium (Lk 14,13.14): „Wenn Du ein Essen gibst, dann lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein. Du wirst selig sein, denn sie können es Dir nicht vergelten.“
Impuls: Am Vorabend des Tages des Herrn haben wir uns (in der Kirche oder auch von zu Hause aus) als Gemeinschaft zum Gottesdienst versammelt. Dabei kommt Jesus Christus selbst in unsere Mitte. Mit ihm zusammen treten wir vor Gott, unseren Vater – gemeinsam mit allen Engeln und Heiligen und den bereits Verstorbenen aller Zeiten, die schon in der Vollendung leben. Zudem sind wir mit allen verbunden, die sich am Sonntag wieder auf der ganzen Welt um den Tisch des Herrn versammeln. Ist es nicht ein großes Glück, in dieser großen Gemeinschaft, in der alle Platz haben, einen Platz einnehmen zu können, auch wenn es nur der unterste sein sollte? --- Egoismus, Hoch-, Übermut und Stolz wirken gemeinschaftszerstörend. Daher mahnt schon der Weisheitslehrer Jesus Sirach zur Bescheidenheit; je höher jemand in dieser Welt aufsteigt, desto mehr soll er sich bescheiden, um bei Gott Gnade zu finden; für die Wunden des Übermütigen gibt es keine Heilung, denn schon an der Wurzel ist er verdorben (vgl. Sir 3,17-18.20.28-29). --- Auch der „Weisheitslehrer“ Jesus betont, dass Selbsterhöhung zur Erniedrigung und Selbsterniedrigung aufgrund der Gerechtigkeit Gottes zur Erhöhung führt (vgl. Lk 14,7-14); am Beispiel des Gastmahls und der einzuladenden Gäste (ausnahmslos Menschen, die die Einladung nicht angemessen erwidern, nicht „vergelten“ können) zeigt er, dass Barmherzigkeit, Demut und Bescheidenheit „gerecht“ sind und zur Seligkeit führen. --- Im Umkehrschluss bedeutet das allerdings auch, dass Stolz und Übermut eine endgültige Rettung verhindern und einen Zugang zur Tischgemeinschaft im Reich Gottes (vgl. den 21. Sonntag im Jahreskreis) blockieren. Ein Anhänger der paulinischen Schule (vgl. Hebr 12,18-19.22-24a) erinnert deshalb daran, dass die Glaubenden schon jetzt Anteil haben an der Gemeinschaft mit Gott („Berg Zion“, „Stadt des lebendigen Gottes“), die ihnen durch den Mittler des neuen Bundes (Jesus Christus) im Heiligen Geist geschenkt ist, dass aber deren endgültige Vollendung im Reich Gottes noch aussteht; dadurch, dass wir alle einmal vor den Richterstuhl Gottes treten müssen und es bereits Gerechte gibt, die schon bei Gott vollendet sind (vgl. Hebr 12,23), erwächst für uns die Lebensaufgabe, uns immer mehr um Güte, Demut und Bescheidenheit zu mühen. --- Grüßen wir in Freude und Dankbarkeit nun unseren Gastgeber, der uns zum Gottesdienst in sein Haus eingeladen hat, und bitten ihn um ein Leben, das wahrhaft „gerecht“ und „selig“ macht.
Gebet (GL 381,5): „Behüt´ mich vor der stolzen Welt, / die allen Sinn dahin gestellt, / von Dir mich abzuwenden. / Wenn sie nicht wird mein Meister sein, / so bleib´ ich durch die Gnade rein / in Deinen guten Händen.“ Amen.
23. Sonntag im Jahreskreis – C (06./07.09.): Weise leben und nachfolgen…
Aus dem Evangelium (Lk 14,27.33): „Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. […] Keiner von euch [kann] mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet.“
Impuls: Wir leben in einer pluralistischen Welt, in der immer mehr alles „gleich gültig“ (und damit oft auch „gleichgültig“!) ist – auch die Art und Weise, wie man lebt. Dabei spielt auch die Selbstbestimmung eine wichtige Rolle; Mahnreden, Umkehrpredigten und moralisierend erhobene Zeigefinger sind verpönt. Solange man damit auf der "Glückswelle" surft und das „Lebensprojekt“ (so wie geplant) zu gelingen scheint, ist das kein Problem… --- Doch wehe, wenn nicht! Denn äußere und innere Krisensituationen können unsere selbstgebastelten Lebensprojekte und –planungen gehörig ins Wanken bringen. Sie führen uns das schmerzlich vor Augen, was wir sehr häufig eben gerade nicht hören möchten: Dass wir eben genau nicht perfekte „Lebensmanager/innen“ sind und dass wir eben gerade nicht alles in der Hand haben. Krisen zeigen, dass die Berechnungen der Sterblichen unsicher und ihre Gedanken hinfällig sind (vgl. Weish 9,14); eine Rettung aus dieser permanenten Unsicherheit kommt einzig und allein durch den Heiligen Geist, der Einsicht in den göttlichen Plan gewährt und die Menschen weise handeln und leben lässt (vgl. Weish 9,17-19). Wer Stolz und Übermut ablegt (vgl. den 22. Sonntag) und immer wieder nach Gottes Lebensplan für sich selbst fragt, für den ist es höchst unwahrscheinlich, dass er in eine grundsätzliche Identitätskrise gerät… --- Als Menschen, deren Leben immer von Unsicherheit und Hinfälligkeit bedroht ist, haben wir uns heute wieder in Jesu Namen zum Gottesdienst versammelt. Wir folgen so dem Ruf Jesu Christi in seine Nachfolge, der an uns erging. Wir haben uns entschieden, sein Wort zu hören und sein Mahl miteinander zu feiern. Im Hören auf sein Wort erfahren wir etwas über Gottes Plan für ein Leben in untrüglicher Sicherheit; in der gemeinsamen Feier des Mahles haben alle Glaubenden bereits jetzt Anteil an jener unzerstörbaren Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus im Heiligen Geist und damit die einzig sichere Grundlage für ein (erfülltes) Leben. So zu leben und sich damit sozusagen auf den Weg Jesu Christi zu begeben und ihm nachzufolgen, stellt uns die Bibel heute als „weise Lebensplanung“ vor; eine solche hat jedoch auch ganz konkrete Konsequenzen für unseren Alltag, den wir ja letztlich als Nachfolgende Jesu Christi so gestalten sollen, wie Jesus Christus es vorgelebt hat. Nur dann, wenn Jesus Christus und seine Lebensweise die grundsätzliche Richtung vorgibt (und eben nicht familiäre Zwänge, Reichtum oder genussorientierte Lebenseinstellungen!), leben wir unser Leben wirklich weise. Das will uns Jesus heute sagen mit seinem Aufruf, unser Kreuz auf uns zu nehmen, ihm nachzufolgen und auf den ganzen Besitz zu verzichten (vgl. Lk 14,25-27.33); nur wer Jesus Christus wirklich nachfolgt, hat sich beim Turmbau eben nicht verrechnet (vgl. Lk 14,28-30) und der hat auch bei drohender Niederlage rechtzeitig über einen Waffenstillstand verhandelt (vgl. Lk 14,31-32). --- Jetzt in dieser Stunde erfahren wir Gemeinschaft mit Jesus Christus und untereinander; und wir werden durch sein Wort und das Brot, das Leben schenkt, ermutigt und gestärkt, den Weg der Nachfolge zu gehen und den Alltag unseres Lebens aus dem Glauben heraus neu zu gestalten. Das kann auch bedeuten, dass bisher geltende und gängige Denkmuster überdacht und ggf. mit Weisheit korrigiert werden müssen. Aus diesem Grund empfiehlt z.B. Paulus seinem Bruder (im Herrn) Philemon, den Sklaven Onésimus nicht mehr als Sklaven, sondern als geliebten Bruder (im Herrn) zu behandeln (vgl. Phlm 9b-10.12-17;16!) – in dem Bewusstsein, dass es in der Nachfolge Jesu Christi nicht mehr die Unterscheidung zwischen Sklaven und Freien gibt, sondern dass alle „einer“ in Christus Jesus sind (vgl. z.B. Gal 3,28). --- Beten wir darum, dass wir durch den Heiligen Geist den Plan Gottes für unser Leben erkennen, Jesus wirklich nachfolgen und so ein weises Leben führen.
Gebet(GL 275,1+4): „Selig, wem Christus auf dem Weg begegnet, / um ihn zu rufen, alles zu verlassen, / sein Kreuz zu tragen und in der Kirche / für ihn zu wirken. – Vater im Himmel, heilig ist Dein Name, / Dein Reich wird kommen, das Dein Sohn verheißen. / Hilf uns, im Geiste ihm den Weg bereiten / als Deine Boten.“ Amen.
Anregungen zu diesen Impulsen wurden i.d.R. entnommen aus: Andreas Gottschalk, Fürbitten in der Gemeinde für die Sonn- und Feiertage. Lesejahr C (Freiburg im Breisgau 2009).
Ausmalbilder zu den Sonntagsevangelien (für Kinder) sind zu finden unter:www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/ausmalbilder_und_textseiten/
© Elmar Feitenhansl (OA St. Georg PW/FT, 25.06.2025)